Mit 2 Wochen Abstand, hat die Story um den jüngsten Radau beim geschichtsträchtigen US-Politikmagazin «The New Republic» auch die Feuilleton-Redaktion der NZZ erreicht. Eine Geschichte, die uns zwar nicht konkret aber immerhin konzeptionell betrifft, etwas später zu verarbeiten ist nichts schlechtes. Im Gegenteil: Die zeitliche Distanz kann helfen, die Emotionen der Betroffenheit etwas abzubauen, um dann umso scharfsinniger die Situation zu analysieren. Dies ist der Autorin des Beitrages «Relaunch oder Ruin» allerdings nicht gelungen. Hat sie doch nur zusammengetragen, was wir seit den turbulenten Tagen Anfang Dezember im Netz an vielen anderen Stellen bereits lesen konnten.
Die kurze Zusammenfassung der Geschichte ist: Ein Investor übernimmt ein gedrucktes Magazin, welches einmal wichtig für die politische Meinungsbildung in den USA war, aber seit Jahren Verluste schreibt, und entscheidet sich dann ein paar Dinge zu ändern, in der Hoffnung dadurch die Verluste in Gewinne zu verwandeln. Der Redaktion gefällt Strategie und CEO des Investors überhaupt nicht und nimmt kollektiv den Hut. Daraufhin wird der Investor von allen anderen Journalisten, ausser den politisch am rechten Rand stehenden, denen «The New Republic» schon immer ein Dorn im Auge war, gedisst und es wird allgemein bejammert dass der neue Technologie-Geldadel sich nun auch noch daran macht, die letzte Bastion politischer Anständigkeit und journalistischem Tiefgang den allgegenwärtigen Listicles und Animierten Gif’s zu opfern.
Missverständnis Nummer 1: Investoren, die Geld verschenken.
Chris Hughes, der im 2012 «The New Republic» gekauft hat, hat dies in der Rolle des Investors und Unternehmers getan, nicht in der des Mäzenen. Ein Investor hat das Ziel, sein Investment mit einem Gewinn wieder zurück zu holen, ein Mäzen verschenkt Geld.
Missverständnis Nummer 2: Mitarbeiter, die mitreden dürfen.
Mitarbeiter haben in einer Aktiengesellschaft nicht die Möglichkeit über die Details der Strategie und der Führungsriege zu entscheiden. Sie können sich systembedingt nur für oder gegen eine von den Eignern gewählte Strategie entscheiden. Zu kündigen ist ihr gutes Recht und ihre einzige sinnvolle Handlungsoption, wenn sie mit dem eingeschlagenen Weg nicht einverstanden sind.
Missverständnis Nummer 3: Wenn alle Mitarbeiter kündigen, ist die gewählte Strategie schlecht.
Wenn (fast) alle Mitarbeiter kündigen wird nur bekundet, dass diese nicht mit der gewählten Strategie einverstanden sind und nicht, ob diese gut oder schlecht an sich ist. Diese Frage wird erst die Zukunft beantworten können. Wobei wir, wenn wir ehrlich sind, diese Frage eigentlich nie werden beantworten können. Denn ob «The New Republic» in 3 Jahren besser oder schlechter dasteht als heute, wird von vielen weiteren Faktoren abhängig sein und ob sie besser dastehen würde, wenn Chris Hughes nicht so gehandelt hätte, werden wir nicht testen können.
Missverständnis Nummer 4: Der Strategiewechsel des «The New Republic» Herausgebers ist gleichzusetzen mit dem Untergang des politischen Journalismus in den USA
Es ist durchaus möglich, wenn auch eher unwahrscheinlich, dass auch in der zukünftigen «The New Republic» aufwändig produzierter, politischer Journalismus verbreitet wird. Wenn nicht, ist das aber kein Weltuntergang denn die politische Debatte ist nicht an einen bestimmten Titel oder an ein bestimmtes Medium gebunden. Wenn «The New Republic» nicht mehr ist werden sich andere Kanäle für die politische Diskussion entwickeln, sofern der Gesellschaft an solchen Debatten überhaupt etwas liegt, was aber eine andere Frage ist.
Missverständnis Nummer 5: Das Internet ist schuld
«The New Republic» hat eine turbulente Geschichte hinter sich und verliert bereits seit 15 Jahren mehr oder weniger kontinuierlich an Leserinnen und Lesern. Die Gründe dafür sind Vielfältig und auf jeden Fall ist in jüngster Zeit auch der Umstand, dass immer mehr Inhalte via Internet verteilt werden, ein wichtiger Faktor, aber wohl kaum der einzige und auch nicht der wichtigste.
Missverständnis Nummer 6: Die Demokratie funktioniert nicht ohne Medienbrands mit grosser Reichweite.
Solange wir dafür sorgen, dass das Internet für alle auch als Publikationsmedium offen bleibt und wir nicht den Fehler machen und den Wunsch der grossen Telekommunikations- und Medienkonzerne zu erfüllen, uns alle wieder zu reinen Konsumenten zu degradieren, müssen wir uns nicht um die Debattierfähigkeit der Öffentlichkeit fürchten. Gesetzlich verankerte Netzneutralität und der demokratisierte Zugang zu Produktions- und Vertriebstechnologie sorgen dafür, dass Demokratie und Politik im Netz stattfinden können.
Hier sind noch ein paar lesenswerte Links zu den Turbulenzen bei «The New Republic»
- A Brief History of The New Republic: From Lippmann to Peretz to Hughes
- The Story of How The New Republic Invented Modern Liberalism
- Disrupting a Republic – Q & A with Chris Hughes
- Should Magazines Like the New Republic Depend on Rich Benefactors? Chris Hughes Doesn’t Think So. And He’s Right
- Crafting a sustainable New Republic von Chris Huges

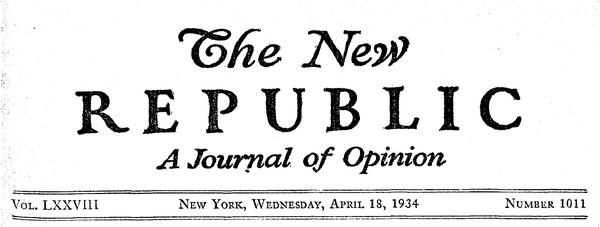




Responses